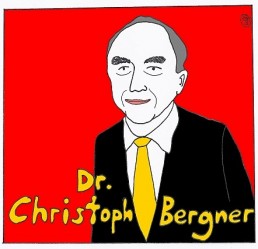Dokumentarfilm - Mit dem Bus durch den Osten...
... die Dritte Generation Ost auf Tour
Mit dem Bus tourten wir im Jahr 2012 durch Ostdeutschland. Die Hintergründe findet Ihr hier. Ein Drehteam unter der Leitung des Regisseurs Gunther Scholz dokumentierte an einigen Stationen unserer Reise.
Das Team: Florian Lampersberger (Kamera), Nadja Smith (2. Kamera, Projektasisstenz), Mathias Kreitschmann/Velin Marcone (Ton), Chris Zschammer (Schnitt), Robert Papst (Musik), Janina Dietz (Gesang)
Der Film: 57 Minuten, HD. c) 2012
Gunther Scholz über den Film:
Eigentlich sollte es ein Film über die 3. Generation Ost werden - und die Bustour darin verwoben. Keiner der angesprochenen Sender hat sich interessiert. Als der Termin immer näher kam, blieb als Rettung nur die Filmhochschule Babelsberg. Von der kam der Kameramann und die Technik und alle arbeiteten ohne Honorar.
Schnitt und Endfertigung wurden erst durch großzügige Förderung der Landeszentrale für Politische Bildung Brandenburg möglich.
Schließlich entstand eine unterhaltsame und informative Tour-Dokumentation über eines der ersten großen Projekte der 3. Generation Ost.
Seine Erstaufführung feierte der Dokumentarfilm auf dem Generationstreffen 2012.
Zurück in Berlin: Am Ende steht ein Anfang!
10. Juni 2012 | 12:19 Uhr
Nach zehn Tagen kommen wir mit muffelnden Koffern und leicht apathischem Lächeln an: Tourabschluss mit Resümee, Lesungen und dem ersten EM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft. Mitten im Wald nahe Potsdam genießen wir im Forsthaus Nordtor noch einmal eine wunderschöne sattgrüne Kulisse, bevor wir wehmütig die pinken Buchstaben der Beklebung „3te Generation Ostdeutschland“ vom Bus abziehen und Jens Försterling uns wieder in Berlin und im Alltag absetzt. „Ich hoffe, ihr werdet mit eurem Projekt noch viel bewegen. Ach, das wird schon komisch, wenn ich morgen mit einer Schulklasse losfahre und neben mir kein Kameramann mehr sitzt,“ sagt er. Wir sind gerührt.
Neben den Einblicken, die Autorin und Wendekind Andrea Hannah Hünninger uns in ihre Weimarer Kindheit gibt, wartet in Potsdam ein weiteres Highlight auf uns: Albrecht Gerber, Chef der Staatskanzlei des Landes Brandenburg, überreicht uns einen Preis für die Initiative als beispielhaftes Demografie-Projekt. In seiner Rede geht er auf Schlagwörter ein, die ihn im Tourprogramm bewegt haben: Der selbstbewusste Titel „Teil der Lösung!“ unseres Auftakts in Schwedt, die mehrdeutige Wendung „Losmachen!“, mit der wir unsere Tour überschrieben haben, und das Motto „Hiergeblieben?!“ unseres Abends in Mittelherwigsdorf. Gerber fügte alles in einem griffigen Plädoyer zusammen: „Ihr seid Teil der Lösung, macht weiter was los und bleibt hier!“
Schon am Tag davor, bei unserem Einzug in die Lutherstadt Wittenberg, war die Sonne endlich durch die Wolken gebrochen. Vorbei an Gauklern, Pfaffen und Mägden schlängelte sich unser Tross zur Evangelischen Akademie direkt neben der berüchtigten Schlosskirche. Die Stadt bereitete sich geschäftig auf das große Ereignis vor, das seit 1989 jedes Jahr Besucher aus der ganzen Welt anzieht: Am Wochenende feierte ganz Wittenberg Luthers Hochzeit mit der aus dem Kloster entflohenen Nonne Katharina von Bora. Überall duftete es schon nach Bratwurst, die Bierfässer wurden angezapft, auf den Bühnen in den mittelalterlichen Höfen lief der Soundcheck.
Wir trafen uns währenddessen mit Jugendlichen, arbeiteten in Workshops ihre Wünsche für die Zukunft heraus und fragten, was sich ändern müsse, damit sie bleiben – eine Frage, die uns auf der ganzen Tour von Schwedt bis nach Potsdam begleitete. Und auch in Wittenberg lautete das Ergebnis: Endlich höhere Gehälter und Löhne in den Neuen Bundesländern, bessere Jobperspektiven und mehr kulturelle Vielfalt, also mehr Freizeitprogramm für die Jugend und auch interkulturelle Angebote. Bevor wir uns ins mittelalterliche Getümmel stürzten, zogen wir geschlossen vor die „Thesentür“ um die Ecke, wo die Wittenberger Schüler ihre Forderungen aufmerksamkeitsstark proklamierten.
„Leuchtgestalten“ hinterließen Eindruck
Beim Frühstück in Wittenberg, kurz bevor unser Bus das letzte Ziel ansteuerte, zogen wir schon mal ein kurzes Fazit. Das war nicht leicht, schließlich sollten es am Ende über 1.900 Kilometer sein, die wir gemeinsam zurückgelegt haben. Was waren unsere bemerkenswertesten Erkenntnisse? Die vielen jungen Engagierten überall haben uns motiviert und inspiriert, Marie Landsberg findet ein schönes Bild für sie: „Leuchtgestalten“, die selbst in finsteren Umgebungen Strahlkraft entfalten. Und neben der Auseinandersetzung mit der Geschichte der DDR, etwa in der Gedenkstätte Bautzen oder auf der Leuchtenburg, bleibt uns der überall geäußerte Wunsch, die europäische Perspektive und den Austausch mit den osteuropäischen Ländern zu stärken, im Gedächtnis.
Die Oberlausitz und das Erzgebirge haben die stärksten Eindrücke hinterlassen, da waren sich viele einig. Maria Wiesner von der FAS hatte den richtigen Riecher, als sie mit Schlafsack in Bus und Abenteuer einstieg, um in der Kulturfabrik Mittelherwigsdorf und in den Sommerzelten hoch oben auf der Bergwiese von Pobershau unter strahlendem Vollmond mit uns zu übernachten. Ihre Reportage ist heute pünktlich am ersten Tag nach der Tour in der Zeitung.
Die Eindrücke müssen sich jetzt erst einmal setzen, die Ergebnisse der vielen Podiumsdiskussionen, Lesungen, Workshops, Hintergrund-, Markplatz- und Lagerfeuergespräche resümiert und die neuen Kontakte zusammengetragen werden. Da machen wir mehr draus! Eines stand am Ende längst fest: Der Mannschaftsgeist stimmte, das Durchhalten hat sich gelohnt und die Tour war – wenn auch nicht immer einfach – am Ende ein Erfolg. Und eigentlich ist das Ende auch kein Ende, sondern ein Anfang. Wie das 1:0 gegen Portugal an diesem Abend.
Fotos und Text: Sabine Weier
Friede, Freude, Eierkuchen?
7. Juni 2012 | 17:53 Uhr
Ein Mobiltelefon nach dem anderen meldet tschechisches Netz, Alexander Fromm pfeift Gruselmelodien durchs Busmikrofon, links und rechts zieht der dunkle Wald vorbei und auf dem Busthermometer beobachten wir beunruhigt, wie die Temperatur Grad um Grad abfällt. Wir sind im Erzgebirge. Auf der Naturschutzstation Pobershau werden wir in „Sommerzelten“ schlafen, droht der Tourplan. Kay Meister begrüßt uns. Er trägt Filzhut und Vollbart, ist der einzige Grüne auf weiter Flur – bei der lokalen Bevölkerung stößt er auf Vorurteile, erzählt er uns später beim gemeinsamen Abendessen. Er hat in Jena Biologie studiert und dort noch ein paar Jahre gelebt. Nach zehn Jahren zog es ihn aber wieder in seine schöne Heimat, wo er als Lehrer arbeitet und die Vielfalt der Flora und Fauna erforscht. Was die Natur angeht: ein Paradies.
Aus dem in Rübenau angesiedelten Sägewerk kommen die Arbeiter mit 700 Euro nach Hause, viele Einwohner sind auf Hartz IV, darunter auch Jugendliche ohne Schulabschluss. Für die 950 Einwohner stehen drei Altersheime bereit. Noch nicht einmal in den lokalen Kneipen sei mehr etwas los, man trinke sein Bier am liebsten vor dem Fernseher. Plastikflasche und Digital-TV. Uff! Ein düsteres Bild zeichnet sich, als wir selbstgemachte Kräuterlimonade im Haus der Kammbegegnung trinken. Der frisch zertifizierte Qualitätswanderweg scheint der einzige Lichtblick über der atemberaubenden Landschaft um Rübenau zu sein – der verspricht mehr Touristen.
Kay führt uns über die blühende Bergwiese, lässt uns wilde Kräuter probieren und erzählt uns von seinen Projekten. Er hat zusammen mit Babette Schreiter den Naturschutzverein „Natura Miriquidia“ gegründet, engagiert sich für eine deutsch-tschechische Kita und bietet Schülerfreizeiten an – dafür sucht er übrigens immer wieder interessierte junge Leute, die für ein paar Wochen im Sommer mitmachen. Wir sind restlos begeistert. Doch auch Kay wird seine Heimat wohl wieder verlassen, sagt er, wenn seine Kinder ins Schulalter kommen.
München des Ostens?
Nach einer Nacht mit Bodenfrost steigen wir wieder in den Bus. Und spannen den größten Bogen der gesamten Tour. Im florierenden Jena treffen wir uns mit der Dezernentin für Stadtentwicklung Katrin Schwarz, weiteren Politikern und Gründern, und fragen, was andere ostdeutsche Städte von Jena lernen können. Schon der massive Berufsverkehr, die vielen Studenten und interessierten jungen Menschen, die wir auf dem Marktplatz treffen, signalisieren: Hier ist richtig was los. Paradiesisch?
„Wissenschaft und Wirtschaft" lautet das Erfolgsrezept der Stadt. Absolventen werden zu Unternehmern und bleiben in Jena. Am Abend geht es im Volksbad dann auch vor allem um die „Luxusprobleme“ der Stadt, die von allen Seiten neidisch beäugt wird. Jena muss dringend Wohnraum schaffen, erklären die Podiumsgäste. Und Jena soll nicht das München des Ostens werden, da ist man sich in der schwarz-rot-grünen Koalition und auch darüber hinaus einig. Die Einkommenssituation in Jena sei aber ohnehin eine ganz andere als in München, merkt noch jemand an.
Der junge Martin Michel von der Partei „Die Guten“ findet dann doch noch ein Haar in der Suppe: Da Jena kaum Leerstand habe, sei es nicht attraktiv für Künstler und Kreative, die Szene wandert nach Dresden, Leipzig und Berlin ab. Auch aus dem Publikum meldet sich jemand zu Wort: Neuer Wohnraum entlaste nur kurzfristig, Elitenbildung und Segregationsprozesse seien vorprogrammiert, das mache Jena unattraktiv, wer wolle dann noch hier wohnen?
Friede, Freude, Eierkuchen ist eben doch nicht überall. Umso schöner ist es, dass wir überall auf junge Leute treffen, die etwas anpacken – egal ob in einem abgelegen Ort in den Bergen oder in einer boomenden Stadt in bester mitteldeutscher Lage wie Jena. Auch in Halle, wo wir am nächsten Tag Vertreter von Attack, Greenpeace, den Heldentagen, dem Preißnitzhaus e.V., der Bürgerstiftung und der Universität kennenlernen, treffen wir auf Pragmatismus und Mut. Ist es das, was die dritte Generation Ostdeutscher ausmacht? Wir bleiben dran.
Fotos und Text: Sabine Weier
„Bei den letzten 20 Prozent Wirtschaftsrückstand stoßen wir an Grenzen“
6. Juni 2012 | 19:32 Uhr
Dr. Christoph Bergner, Beauftragter der Bundesregierung für die Neuen Bundesländer, diskutiert am 7. Juni 2012 in Halle mit Vertretern der 3ten Generation Ost und Dr. Jutta Günther vom Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) zur Frage: „Kann Ostdeutschland auch ohne Förderung?“. Im Interview haben wir schon mal vorgefühlt und auch nach den Erfahrungen der Familie Bergner gefragt.
Was gehört als Beauftragter für die Neuen Bundesländer zu Ihren Aufgaben?
Beauftragte gibt es für verschiedene Sachverhalte, die Rolle besteht darin, an allen Fragen und Entscheidungen der Bundesregierung, die diesen Sachverhalt betreffen, beteiligt zu sein. Also in meinem Fall an Entscheidungen, die eine besondere Relevanz für Ostdeutschland haben. Darüber hinaus habe ich regelmäßig den Bericht zur Deutschen Einheit für das Parlament vorzulegen und natürlich zu diskutieren. Und der Beauftragte für die Neuen Länder ist Ansprechpartner für die Anliegen der ostdeutschen Landesregierungen.
Sie befassen sich vor allem mit der wirtschaftlichen Entwicklung. In Sachen Wirtschaftskraft liegen die neuen Länder hinter den alten zurück, wird das so bleiben?
Die Frage der wirtschaftlichen Angleichung des Ostens an den Westen war und ist die Schlüsselfrage des Aufbaus Ost. In dieser Hinsicht haben wir in den zurückliegenden 22 Jahren sehr viel erreicht. Bei den letzten 20 Prozent Wirtschaftsrückstand stoßen wir an Grenzen, die strukturelle Ursachen haben. Im Osten fehlen die großen Konzernzentralen. Mit diesen Zentralen sind hochwertige Dienstleistungsaufträge sowie hohe Gewinn- und Einkommensabrechnungen verbunden, die sich in der Steuerkraft widerspiegeln – und nicht zuletzt auch die großen wirtschaftseigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilungen.
Auf der anderen Seite werden ja Konzerne und auch mittelständige Unternehmen in einigen Regionen langfristig Probleme haben, ihre Stellen zu besetzen. Viele junge Menschen verlassen ihre Heimatorte. Ist die „Vergreisung“ noch zu stoppen?
Das ist ein gesamtdeutsches Phänomen. Wir haben in ganz Deutschland keine nachhaltige Geburten- und Nachwuchsentwicklung. Dieser Effekt der Überalterung hat sich in ostdeutschen Ländern durch die Abwanderung der 1990er Jahre verstärkt, die Geburtenrate hat sich im Osten halbiert. Das verschärft im Durchschnitt die Verhältnisse in den neuen Ländern, aber auch innerhalb Ostdeutschlands gibt es enorme Unterschiede. Wir haben ja auch viele für die Jugend attraktive Standorte, dort stellt sich auch die Alterstruktur ganz anders dar. Wir müssen uns der gesamtdeutschen Herausforderung „Demografie“ stellen.
Müssen auch neue Konzepte zur Förderung der Immigration entwickelt werden?
Von der Zuwanderung nach Deutschland ist der Osten in den vergangenen Jahren vergleichsweise wenig betroffen gewesen. Selbst die Zuwanderung aus unseren östlichen Nachbarländern ist mehr in die Zentren des Westens gegangen. Aber prinzipiell glaube ich, gerade mit Blick auf die östlichen Nachbarn, sollten wir uns auf mehr Offenheit und Integration in den gesamteuropäischen Arbeitsmarkt einstellen.
Wo liegen die Stärken der Neuen Bundesländer?
Die Neuen Bundesländer weisen Besonderheiten auf, die gerade für junge Menschen attraktiv sind. Ostdeutschland ist von den Transformationsstaaten des Ostens nach 1990 die am weitesten fortgeschrittene Region, bei der die Strukturen, etwa die Rechtssicherheit und westeuropäische Standards, zuerst erreicht wurden. Aber sie sind natürlich gleichzeitig noch von den Transformationsereignissen gekennzeichnet, zum Beispiel in Wirtschaft oder Infrastruktur. Ostdeutschland ist die Transformationsregion mit den stärksten Fortschritten und deutlichsten Resultaten.
Sie haben selbst drei Kinder. Gehören sie zur dritten Generation Ostdeutscher, sind sie also ca. zwischen 1975 und 1985 geboren?
Jahrgang 79, 83 und 85 – das passt also genau.
Was hat die Wendeerfahrung und das Aufwachsen in „zwei verschiedenen Ländern“ ihnen aus Ihrer Sicht mitgegeben? Und: Ist das in der Familie Bergner Thema?
Ja, Thema ist das natürlich. Unsere Kinder nahmen aufmerksam Anteil, vor allem am Transformationsprozess, den wir – meine Frau als Stadträtin und ich im Landtag und später im Bundestag – zu bestehen hatten. Also Themen wie den Aufbau neuer Hierarchien an Schulen, Hochschulen, in Politik und im öffentlichen Leben. Aus der Elternperspektive fällt mir außerdem auf, dass die Erinnerung an die politische Situation in der DDR inzwischen mit einer gewissen spöttischen Distanz gesehen wird, jedenfalls frei von jeder Nostalgie. Als mal eine CD mit FDJ- und Pionierliedern kursierte, hörten unsere Kinder das eher so, als wäre das irgendeine Kabarettvorstellung. Ansonsten ist die Freiheit einer offenen Gesellschaft zur Selbstverständlichkeit geworden. Wir müssen dann schon manchmal nachfragen, ob sie denn nicht wüssten, was es bedeutet, ohne Grenzkontrollen durch Europa zu reisen, oder dass sie ihre Praktika in Afrika oder Papua Neuguinea machen können. Das war für uns natürlich unvorstellbar.
Illustration: Alexander Fromm, Interview: Sabine Weier
„Unsere Generation muss jetzt klar formulieren, was sie will"
5. Juni 2012 | 15:56 Uhr
Als Dezernentin für Stadtentwicklung gestaltet Katrin Schwarz Jena mit, eine der aufstrebenden Städte in Ostdeutschland. Wie können wir von Jena lernen? Dieser Frage geht die Podiumsdiskussion am 6. Juni 2012 nach, wenn der Bus der 3ten Generation Ost Station an der Saale macht. Im Interview gibt Katrin Schwarz schon mal Einblicke in ihre Arbeit, die Entwicklung der Stadt und ihre persönliche Sicht auf die dritte Generation Ostdeutscher.
Sie sind Jahrgang 1972, waren also noch recht jung, als die Mauer fiel. Die Initiative 3te Generation Ost setzt sich damit auseinander, wie die Sozialisierung in zwei Systemen Menschen geprägt hat. Wie denken Sie darüber?
Beide Systeme erlebt zu haben, empfinde ich als Vorteil. Möglicherweise sind wir mit den ganz großen Visionen nicht mehr ganz so leicht einzufangen. Wir sind pragmatisch und zielstrebig – das erlebe ich auch viel im Freundeskreis. Es ist schon eine einmalige Situation für ein Land, eine Generation zu haben, die beide Erfahrungen mitbringt. Ich begrüße es sehr, dass wir jetzt anfangen, das zu diskutieren. Für mich hat die Initiative nichts damit zu tun, alte Klischees wieder aufzuwärmen. Das wäre fatal. Aber man kann diese Generationserfahrung – geboren in der DDR und aufgewachsen in der Bundesrepublik – durchaus nutzen, um auch Fragen an die eigene Elterngeneration zu formulieren.
Was würden Sie in den Diskurs über die dritte Generation einbringen?
Ganz klar einen Aufruf zu mehr Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen. Unsere Generation muss erwachsen werden und klar formulieren, was sie will. Wie stellen wir uns Partizipation vor? Was für ein Politikverständnis haben wir? Wie wollen wir an diesen Prozessen teilhaben? Und gerade in meinem Bereich der Stadtentwicklung: Welche Wohnformen wollen wir? Wie stehen wir zur Frage der Wohneigentumsbildung? Das sind Themen, die mich beruflich beschäftigen. Und ganz privat habe ich mir natürlich schon die Frage gestellt, ob ich wieder zurückkommen soll. Ich bin in Jena aufgewachsen, war dann aber viele Jahre unterwegs, habe Architektur am Bauhaus Weimar studiert, meinen Master in Oxford gemacht und in Frankfurt am Main mein zweites Staatsexamen im Städtebau für den höheren Dienst abgelegt. Das sind Erfahrungen, die mich persönlich stark geprägt haben.
Und wie war es dann, nach Jena zurückzukommen?
Es war nicht ganz einfach, aber die Dynamik, die wir hier in der Stadt haben, macht vieles sehr interessant. Es geht ja vor allem darum, neue Wege auszuprobieren. Jena ist eine alte gewachsene Stadt mit einer hohen Akademikerquote, das war schon immer so. Auch die hier entstandenen Industrietraditionen, etwa Schott, Zeiss und Jenoptik und heute eben auch e-Commerce-Firmen und der ganze Bereich der Biotechnologie. Dadurch sind bestimmte Wege vorgezeichnet, wie auch durch die große Universitätstradition. Wir leben ganz maßgeblich von dieser Substanz. Hier knüpfen wir an, aber dies reicht natürlich nicht. Im Vergleich zu anderen ostdeutschen Kommunen verzeichnen wir hier auch ein leichtes Bevölkerungswachstum. Die Universität entwickelt sich toll und wächst, in den kommenden Jahren wollen wir gemeinsam mit der Universität einen neuen Campus bauen.
Woran liegt es, dass so viele junge Menschen sich für ein Studium in Jena entscheiden?
Auf der einen Seite liegt das natürlich an dem hochwertigen Angebot der Universität. Und die Lebensverhältnisse sind hier sehr angenehm. Es ist nicht Berlin oder München, die Stadt ist überschaubar, das kann gerade für Studierende sehr von Vorteil sein. Dazu kommt die florierende Gründerszene. Viele Errungenschaften der Forschung münden direkt in kleinen Start Ups. Dafür ist das Klima hier sehr gut und wir als Stadt tun auch eine ganz Menge dafür, dass es sich so weiterentwickelt.
Welche Herausforderungen kommen in den nächsten Jahren auf Jena zu?
In meinem Arbeitsgebiet sind wir vor allem mit Herausforderungen im Bereich Wohnungsbau konfrontiert. Wir sind eine wachsende Stadt, haben aber nicht viel Fläche, gerade entwickeln wir Konzepte, um dem zu begegnen. Ein spannendes Objekt mit Wohnraum und Läden setzen wir jetzt mit „J. Mayer H.“ um, das ist ein sehr renommiertes Architekturbüro. Die Fassadengestaltung wird spektakulär, das hatten wir hier in Jena noch nicht. Wir beschäftigen uns gerade auch mit dem Thema Eigentumsbildung – das könnte für die Weiterentwicklung des Standortes noch sehr wichtig sein. Gerade im Vergleich zu vielen westdeutschen Kommunen haben wir hier Nachholbedarf. Eine wichtige Frage ist auch, ob es gelingt, Fachkräfte mit ihren Familien zu halten oder anzuwerben. Auch an Jena geht der demografische Wandel nicht spurlos vorbei. Letztlich geht es um ein friedliches Zusammenleben aller Generationen.
Illustration: Alexander Fromm, Interview: Sabine Weier
Sorbische Metalbands und Pizza im Haus Schminke
5. Juni 2012 | 15:30 Uhr
Ob sich eine Rockband wohl auch so fühlt? Das fragen wir uns nach sechs Tagen im Bus. Ausreichend Presse ist jedenfalls an Board. Neben Ulrike Nimz von der Freien Presse, die ganze acht Tage mitzieht und regelmäßig berichtet, sitzt mal jemand von Zeit Online mit am Tisch, mal eine Spiegel-Reporterin mit im Bus. Eine junge Journalistin der FAS kommt gleich mit Schlafsack nach Bautzen und übernachtet mit uns in Mittelherwigsdorf und in Pobershau – zwei Orte abseits der ostdeutschen Zentren, in denen sich trotzdem einiges tut.
In Zossen gießt es in Strömen, als wir uns mit Swantje Tobiassen von der Amadeu Antonio Stiftung und den Skatern der Stadt treffen. Sie zeigen uns selbstgebaute Mini-Skateparks in abgelegenen Winkeln, den Lidl-Parkplatz, auf dem sie ihre ersten Versuche starteten und die große Profi-Rampe, die sie mithilfe gesammelter Gelder aufziehen konnten – Hut ab! Nach einem Austausch mit den Initiativen vor Ort, einem Besuch in der Bücher-und Bunkerstadt, einer urigen Übernachtung und Frühstück im Keglerheim verlassen wir Neubrandenburg in Richtung Sachsen.
Nachdem wir uns in Bautzen das Kulturzentrum Steinhaus angeschaut haben, teilt sich die Gruppe. Sven Riesel führt eine Hälfte durch den ehemaligen Stasiknast, die andere Hälfte trinkt starken Kaffee im Büro von Clemens Škoda und spricht über sorbische Metalbands und weltweites Netzwerken. Noch am Nachmittag schlängelt sich unser Busfahrer Jens Försterling, dem wir an dieser Stelle mal ein dickes Danke aussprechen, mit uns durch die absurd schmalen Straßen der Oberlausitz und bringt uns sicher zur Kulturfabrik Meda, die eine Gruppe von Leuten aus ganz Deutschland in ihrer Wahlheimat Mittelherwigsdorf betreibt.
Das „neue Selbstbewusstsein Ost“
Mit über 30 Gästen aus Orten wie Görlitz oder Zittau diskutieren wir in den wunderschönen Räumen der Kulturfabrik Meda über die Visionen der dritten Generation in der Region. Dabei geht es auch mal etwas kontroverser zu und das ist gut, schließlich sind wir auch unterwegs, um eine Debatte zu entfachen. Und um Ideen und Tipps einzusammeln, wie den zum Buch „Phase 0 – How to make some action“, in dem Macher aus der dritten Generation Projekte wie Festivals oder Clubs vorstellen. Beim Grillen am Abend kommt wieder ein Gefühl auf, das in den vergangenen Tagen schon viele geschildert haben: Das „neue Selbstbewusstsein Ost“ einer Generation, die ihren Weg selbstständig geht und etwas bewegen will.
Am nächsten Morgen, viel früher als Rockbands losfahren würden, geht’s weiter nach Löbau, wo wir uns das Haus Schminke anschauen – eine echte Architektur-Perle. Der Löbauer Nudelfabrikant Fritz Schminke ließ es in den 1930er Jahren von Hans Scharoun entwerfen. Es gießt immer noch. Aber die Atmosphäre hier ist ohnehin so angenehm, dass wir uns für ein paar Stunden einnisten, Pizza bestellen, netzwerken, schreiben. Johannes Staemmler haut währenddessen in die Tasten des Klaviers, an dem früher eine der Schminke-Töchter spielte. Als sein Blues durch die moderne Wohnlounge hallt, stellt sich noch mal das Rockstar-Feeling ein. Und dann geht’s weiter in Richtung Pobershau.
Fotos & Text: Sabine Weier
Aufarbeitung in Bautzen
4. Juni 2012 | 07:25 Uhr
Wendekind Sven Riesel, Jahrgang 1980, arbeitet als wissenschaftlicher Mitarbeiter der Gedenkstätte Bautzen die berüchtigte Geschichte des Stasigefängnisses in der sächsischen Stadt auf. Sowohl im Stasiknast als auch im zweiten Bautzener Gefängnis, dem „Gelben Elend“, saßen unzählige politische Gefangene ein. Wir sprachen mit Sven über seine Arbeit, über seine Wahlheimat Dresden und über „Ossis“ und „Wessis“.
Bist Du Bautzener?
Nein, ich komme aus Pulsnitz in der Westlausitz. Studiert habe ich in Dresden, Technik-, Wirtschafts- und Sozialgeschichte und Germanistik. Da wohne ich auch seit über zwölf Jahren, jetzt pendle ich nach Bautzen. In der Gedenkstätte habe ich schon während des Studiums gearbeitet, Führungen und Schülerprojekte durchgeführt und Rechercheaufgaben übernommen. Nach dem Studium habe ich für kurze Zeit noch mal in einem anderen Museum gearbeitet, aber dann hat es mich wieder zurück zur Gedenkstätte Bautzen gezogen. Mich hatte das Thema nicht losgelassen – ich finde das einfach spannend und auch wichtig, die Geschichte der politischen Gefangenschaft im 20. Jahrhundert aufzuarbeiten.
Du führst uns durch die Gedenkstätte, was erwartet uns?
Das Gefängnis, das als Stasiknast traurige Berühmtheit erlangt hat, liegt mitten in einem Villenviertel, in dem man so einen Knast gar nicht vermutet. Anhand von einzelnen Geschichten und Lebensläufen werde ich Wege nach Bautzen und die Methoden der Stasi veranschaulichen. Schon ab 1933 waren in Bautzen die ersten Unschuldigen eingesperrt, nach dem Krieg nutzten die sowjetischen Besatzer die Haftanstalten und auch in der DDR waren dann politische Gefangene inhaftiert. Die Bezeichnung „Gelbes Elend“ für das zweite Gefängnis in der Stadt ist vor allem in der älteren Generation bekannt, das liegt an den gelben Ziegelsteinen, aus denen das Gebäude erbaut wurde, „Elend“ natürlich wegen den schlechten Haftbedingungen. Heute ist es als JVA Bautzen immer noch in Betrieb.
Für Dich ist die Stasigeschichte schon allein wegen Deiner Arbeit sehr präsent. Aber wie ist das denn ansonsten im Alltag der Menschen?
Es gibt ein ganz deutliches Gefälle in der Wahrnehmung dieses Themas. Die ältere Generation hat natürlich ganz konkrete Erinnerungen daran. Bei der dritten Generation ist das ja schon anders. Wenn ich an die DDR denke, dann vor allem an samstags Schule und den Geruch im Intershop. Oder an die Zeit, in der die Mauer fiel – was das für eine Unruhe war und wie alle gar nicht wussten, was da gerade passiert und wie es jetzt weitergeht. Ich selbst habe einen sehr geschichts- und kulturinteressierten Freundeskreis, da ist die Stasivergangenheit immer mal wieder Thema, aber im Großen und Ganzen könnte das mehr werden. Die ältere Generation hat großes Interesse an der Gedenkstätte, weil sie zum Beispiel jemanden kennen, der da mal einsaß. Den Jüngeren muss man oft erst klar machen, was für eine Bedeutung eigentlich dahinter steckt.
Du hast Dich für Dresden als Wohnort entschieden, wie lebt es sich dort?
Die Stadt ist einfach unschlagbar, gerade für unsere Generation. Das Kulturleben gibt jede Menge her. Im Gegensatz zu vielen anderen ostdeutschen Städten ziehen hier viele aus unserer Altersgruppe her, es gibt junge Familien, auch Engagement und Initiativen. Wird zum Beispiel eine Kita geschlossen, nehmen die Leute das nicht einfach hin, sondern wehren sich mit einer Elterinitiative.
Hast Du das Gefühl, dass es Deine Persönlichkeit beeinflusst hat, in zwei Systemen aufgewachsen zu sein?
Sich selbst einschätzen, ist ja immer schwierig. Aber ich würde schon sagen, dass das prägend war. Für mich ist es schon allein für die Arbeit wichtig, die DDR noch gekannt und darin gelebt zu haben. Dadurch habe ich zum Beispiel einen einfacheren Zugang zur zweiten Generation, was ja auch für meine Arbeit wichtig ist. In zwei deutschen Staaten aufgewachsen zu sein, war jedenfalls kein Nachteil für mich. Aber ich muss ehrlich sagen: Mir geht das Ost-West-Gerede manchmal schon auf die Nerven. Schließlich verfolgen wir einen europäischen Gedanken – ob „Ossi“ oder „Wessi“.
Illustration: Alexander Fromm, Interview: Sabine Weier
Schwerin im Sturm erobert
3. Juni 2012 | 11:03 Uhr
Mit Rostocker und Lübzer Pils, Würstchen vom Biohof Medewege auf dem Grill und Eroberungslaune stimmen wir uns am ersten Abend in Schwerin auf die dritte Generation in der Landeshauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns ein. Und die begeistert restlos, selbst Adriana Lettrari. Die gebürtige Rostockerin erzählt uns von der Fehde zwischen ihrer Heimatstadt an der Küste und Schwerin, und davon, wie sie sich in den sechs Monaten, in denen sie hier arbeitete und lebte, dann doch überzeugen ließ: Schwerin verdient den Hauptstadtstatus.
Bei einem spontanen Nachtspaziergang durch die Pflastersteingassen entdecken wir im Licht der Straßenlaternen wunderschöne historische Fassaden, das malerische Seeufer mit Segelboten und das beeindruckende Schloss, Sitz der Landesregierung. Einige erinnert es an „Dis-nee“. Und als wir die Türen des Doms öffnen und in dem imposanten Bau ein fast 100 Köpfe starker Chor Bach singt, sind wir hin und weg.
Guter Dinge entern wir am nächsten Morgen das Ministerium für Gleichstellung, Arbeit und Soziales. Manuela Schwesig thront dort und hat uns zu einem Hintergrundgespräch eingeladen. Als wir die Ziele der 3ten Generation Ost vorstellen wird klar: Mit Manuela Schwesig, Jahrgang 1974, haben wir eine Mitstreiterin im Boot. Sie erzählt uns von ihren Erfahrungen als Wendekind, davon, wie sie die Umbrüche erlebt hat, auf sich gestellt, ohne Unterstützung durch Eltern, die ja selbst erstmal mit einem neuen System klarkommen mussten. Beim gemeinsamen Brunch mit der dritten Generation Schweriner sagt sie noch mal: „Die Erfahrungen dieser Generation sind wertvoll, wir müssen jetzt etwas daraus machen!“
Hier ist was los!
Wir tauschen uns mit vielen jungen Menschen aus und hören: In Schwerin ist richtig was los, zum Beispiel im Club Zenit oder im Achteck, einige von uns probieren noch am Abend den berüchtigten Freischütz aus, eine Traditionskneipe am Ziegenmarkt. Demnächst soll auch ein selbstorganisiertes Festival mit elektronischer Musik starten. Hört sich doch gut an, oder? Viele aus der dritten Generation verlassen die Stadt trotzdem, und auch hier liegt das vor allem an den fehlenden Job-Perspektiven, einzig die Call-Center-Branche boomt scheinbar in ganz Ostdeutschland – auch in Schwerin hören wir davon.
In verschiedenen Workshops am Nachmittag entwickeln wir Ideen für die Zukunft, planen Netzwerkgruppen der 3ten Generation Ost in Mecklenburg-Vorpommern, sprechen über die Aufbruchstimmung in der Gegenwart und mit Martin Klähn über die nach dem Mauerfall. Er gründete damals das Neue Forum mit, hatte sich schon in den intensiven Monaten zuvor in der Bürgerrechtsbewegung engagiert, und erzählt uns von seiner ersten Reaktion: „Scheiße, die Mauer ist weg!“ und von enttäuschten Hoffnungen. Und so kommt die Frage auf: Was sind unsere Visionen? Ideen haben wir, vor allem kommt es jetzt aber darauf an, Stimmen und Gefühle einzufangen. Auf der Bustour und auch sonst, raus damit!
Schwerin und Manuela Schwesig haben wir im Sturm erobert. Wir lassen Mecklenburg-Vorpommern hinter uns und sind wieder on the Road. Auf nach Zossen Genossen!
Fotos und Text: Sabine Weier
Kontroverser Spielverlauf zwischen den vier Toren Neubrandenburgs
1. Juni 2012 | 19:26 Uhr
Der Teamgeist kommt immer mehr in Fahrt, die Mannschaft hat sich eingegroovt und auch die Sonne bricht hier und da mal durch die Wolkendecke, als wir Neubrandenburg ansteuern. Zwischen den Schwedter Plattenbauten und denen in der Stadt im Zentrum der Mecklenburgischen Seenplatte liegen – malerisch, aber wahr – saftig grüne Wiesen, von Kornfeldern, strahlend-gelbem Raps und tiefrotem Klatschmohn durchsetzt. Aaaaahhhs und Ooooohhhs klingen durch den Bus und immer wieder raunt ein Staunen durch die Reihen, wenn Filmemacher Gunther Scholz und Kameramann Florian Lampersberger mal wieder mit dem Auto an uns vorbeigerauscht sind und sich an einer Landstraßenkurve postiert haben, um unseren schicken Bus im Vorbeifahren zu filmen.
Wir checken etwas außerhalb im Sportinternat ein und ziehen neugierige Blicke auf uns, als wir ins belebte Stadtzentrum fahren. Unser Positionsspiel auf den Marktplatz wird zunehmend besser, doch auch in Neubrandenburg ist es nicht einfach, mit der dritten Generation ins Gespräch zu kommen. Selbst die Neugierigen machen dann doch lieber einen Bogen um uns. Ein paar Stimmen können wir trotzdem einfangen, und auch von den Herausforderungen erfahren, mit denen Neubrandenburg kämpft: Wenige Jobs und mageres Freizeitprogramm für junge Menschen, ganze Straßenzüge mit über 80 Prozent Hartz-IV-Empfängern, Gettoisierung. Doch auch von Lichtblicken, wie einer wachsenden alternativen Szene, erzählen uns die Passanten.
Ganz andere Eindrücke bringen einige von den Schulworkshops mit. „Eva“, die evangelische Schule St. Marien, wurde von einer Elterninitiative ins Leben gerufen, einer kleinen bürgerlichen Schicht, zu der vor allem Zugezogene aus den alten Bundesländern zählen. Wende und DDR-Vergangenheit sind für die Schüler dann auch kaum Thema, die Gemeinschaft wirkt wie ein Kokon, abgeschottet gegen das, was da draußen noch in einigen Köpfen arbeitet.
Spitzel und Spitzensportler
Am Abend wartet harte Kost auf uns: Das Panel „Sport als Propaganda, Sport als Engagement“ rollt die Stasigeschichte des SC Neubrandenburg auf. Schon bei der Vorbereitung in den Tagen vor der Tour merken wir: Mit dem Thema treffen wir einen wunden Punkt. Zu DDR-Zeiten brachte der renommierte Sportclub eine Reihe Vorzeigesportler hervor, darunter Leichtathleten, Triathleten und Kanufahrer. Allerdings war die Führungsriege die meiste Zeit damit beschäftigt, die Talente von der Republikflucht abzuhalten und auf Linientreue zu eichen, und nicht selten wurden Spitzensportler und Studenten der Sporthochschule zu IMs, inoffiziellen Mitarbeitern der Stasi.
Mit auf dem Panel sitzt André Keil, dessen Dokumentarfilm „Als aus Sportlern Spitzel wurden“ Licht in das dunkle Kapitel des Sportvereins bringt – ein paar Tage vor unserem Tourstopp zeigt das NDR ihn zum zweiten Mal im Fernsehen. Geschichte aufrollen? Das passt nicht jedem ehemaligen DDR-Bürger, auch aus dem Publikum kommen mürrische Stimmen. Doch Aufarbeitung muss sein, findet auch Regisseur André Keil: „Noch schieben vor allem Journalisten die Auseinandersetzung mit der Vergangenheit an, da muss noch viel passieren. Gerade ihr, die dritte Generation, werdet künftig noch mit der Aufarbeitung beschäftigt sein.“
Das Thema ist so heiß, dass die Zukunft und „Sport als Engagement“ ein wenig zu kurz kommen. Doch Lennart Claussen hat Gelegenheit, das Projekt „Mobile Beratung im Sport" des Landessportbundes Mecklenburg vorzustellen. Er berät Sportvereine in Mecklenburg-Vorpommern unter anderem dazu, wie sie gegen Rechtsextremismus in eigenen Reihen vorgehen können.
Vier wunderschöne historische Tore säumen übrigens den Stadtkern, dessen sozialistische Architektur ordentlich Eindruck bei uns hinterlassen hat. Am Abend spielen Deutschland und Israel im Freundschaftsspiel auf zwei. Im urigen „Konsulat“ flackert das Spiel über die Leinwand, wir stärken uns mit deftiger Küche und kühlem Bier, und reden noch lange darüber, wie man Vergangenes aufarbeiten und für die Zukunft nutzen kann. Denn ähnlich wie im Fußball gilt auch für die Gesellschaft: Chancen verwandeln!
Artikel von Ulrike Nimz in der Freien Presse
Illustration: Alexander Fromm, Text & Foto: Sabine Weier
Tourtag 1: Crashtest in Schwedt
31. Mai 2012 | 09:55 Uhr
Mit Rotkäppchen-Sekt in den Bechern, Adrenalin im Blut und einem stärkenden Grußwort von Ulrich Mählert, Projekt-Pate von der Stiftung Aufarbeitung der SED-Diktatur, im Rücken rollen wir aus Berlin raus und rein in den ersten Tourtag. Gunther Scholz und sein Filmteam sind von Anfang an dabei und genauso gespannt wie wir: Was passiert? Wen treffen wir? Wie bestehen wir den „Chrashtest mit der Wirklichkeit“, von dem Gunther sprach?
Die Stimmung pendelt sich irgendwo zwischen Ferienlagervorfreude und dem Gefühl ein, dass in den kommenden zehn Tagen etwas Großes auf uns wartet. Auch große Herausforderungen, denn schließlich steuern wir nicht nur Gute-Laune-Paradiese an, sondern bewusst Orte, an denen die dritte Generation Ostdeutscher noch viel bewegen kann. Wie in Schwedt, unserem ersten Tourstopp.
Wir fahren vorbei an den Uckermärkischen Bühnen, einem sozialistischen Prachtbau mit kupferfarben glänzender Glasfassade, der an den abgerissenen Palast der Republik in Ostberlin erinnert. Am Abend werden wir dahinter mit zehn Protagonisten aus Politik, Wirtschaft und Kultur diskutieren, wie man junge Menschen wieder für Schwedt begeistern kann. „Teil der Lösung!“ haben wir den Abend übertitelt, wir wollen konstruktiv nach vorne schauen. Unter den Diskutanten sitzt auch Dimitri Hegemann. Er hat den Berliner Techno-Club Tresor gegründet und arbeitet gerade im Auftrag der Stadt daran, Schwedt „cooler“ zu machen.
Teenager und Plattenbauromantik
Einen guten Club könnte Schwedt brauchen, bestätigen uns auch die Teenager, die wir mittags auf dem „Platz der Befreiung“ zwischen Plattenbauten und Supermärkten treffen. Sie alle werden nach der Schule wohl weggehen, sagen sie, vor allem, weil der Arbeitsmarkt kaum Perspektiven bietet. Auch in den Schulworkshops im Gauß-Gymnasium kommt dieses Thema auf. Es muss etwas passieren!
Unter dem grauen, wolkenverhangenen Himmel wirken unsere bunten Sonnenschirme und Liegestühle ein wenig verloren, ziehen aber jede Menge Blicke auf sich. Wir sprechen mit der vierten, zweiten und ersten Generation – von den „Dritten“ laufen uns nur wenige über den Weg, auch später beim geführten Spaziergang durch die Stadt, die nach 1961 um Papierfabrik und Chemiekombinat herum in klassisch sozialistischer Manier angelegt wurde. Von den gigantischen Plattenbauwüsten wurden große Teile nach der Abwanderungswelle in den 1990er Jahren wieder abgerissen.
„Wir müssen polnischer werden!“
Am Abend verdichtet sich das graue Bild: Das Lohnniveau ist niedrig, die Schüler vermissen ihr Schwimmbad, die von Schließung bedrohte Kinderklinik sucht händeringend nach einem Arzt. Bürgermeister Jürgen Polzehl war am Vorabend höchstpersönlich mit einem potenziellen Kandidaten essen. Aber auch Lösungsansätze zeichnen sich ab. Und einige motivierte junge Schwedter sitzen mit an den Diskussionstischen. Sie lieben ihre Heimat und wollen etwas bewegen.
Aber Schwedt muss sich für die dritte und vierte Generation öffnen, Hausverwaltungen dürfen sich bei WG-Gründungen nicht quer stellen, höhere Gehälter und ein breiteres kulturelles Angebot müssen her. Und: Der Austausch mit dem benachbarten Polen ist ausbaufähig, denn hier wartet eine aufgeschlossene dritte Generation auf Perspektiven. „Wir müssen polnischer werden!“ resümiert Intendant der Uckermärkischen Bühnen Reinhard Simon.
Wir nehmen jede Menge Impulse und Kontakte mit, als wir im Dunkeln mit unserem großen silbernen Bus zur alten Tabakfabrik in Vierraden rollen, wo wir den Abend bei Wein und spontanem Biografie-Austausch ausklingen lassen. Das beeindruckende Gelände entpuppt sich als heimliches Highlight des Tages: Von 1990 an stand das historische Gebäudeensemble leer, bis Engagierte im Jahr 1999 den kunstbauwerk e.V. ins Leben riefen. Zwischen roten Backsteinen und alten Holzbalken begegnen sich hier Studierende von Hochschulen aus Polen und Brandenburg und andere Gruppen. Die wichtigste Veranstaltung ist seit über zehn Jahren das deutsch-polnische Kunstsymposium „oder | odra“: Jeden Sommer bespielen Künstler die wunderschönen Räume mit Arbeiten und entwickeln gemeinsame Positionen. Teil der Lösung!
Illustration: Alexander Fromm, Text: Sabine Weier